Unter Federführung des überkonfessionellen Augsburger Gebetshauses fand in der Karwoche ein digitales Gebetsevent statt, das von mehr als einer halben Million Menschen im Internet und im Fernsehen verfolgt wurde. Schon im Vorfeld wurde die evangelikal und charismatisch geprägte Aktion kontrovers diskutiert. Martin Fritz berichtet, sichtet und gewichtet.
Deutschland betet gemeinsam – Eine digitale Gebetsaktion in Zeiten geschlossener Kirchen
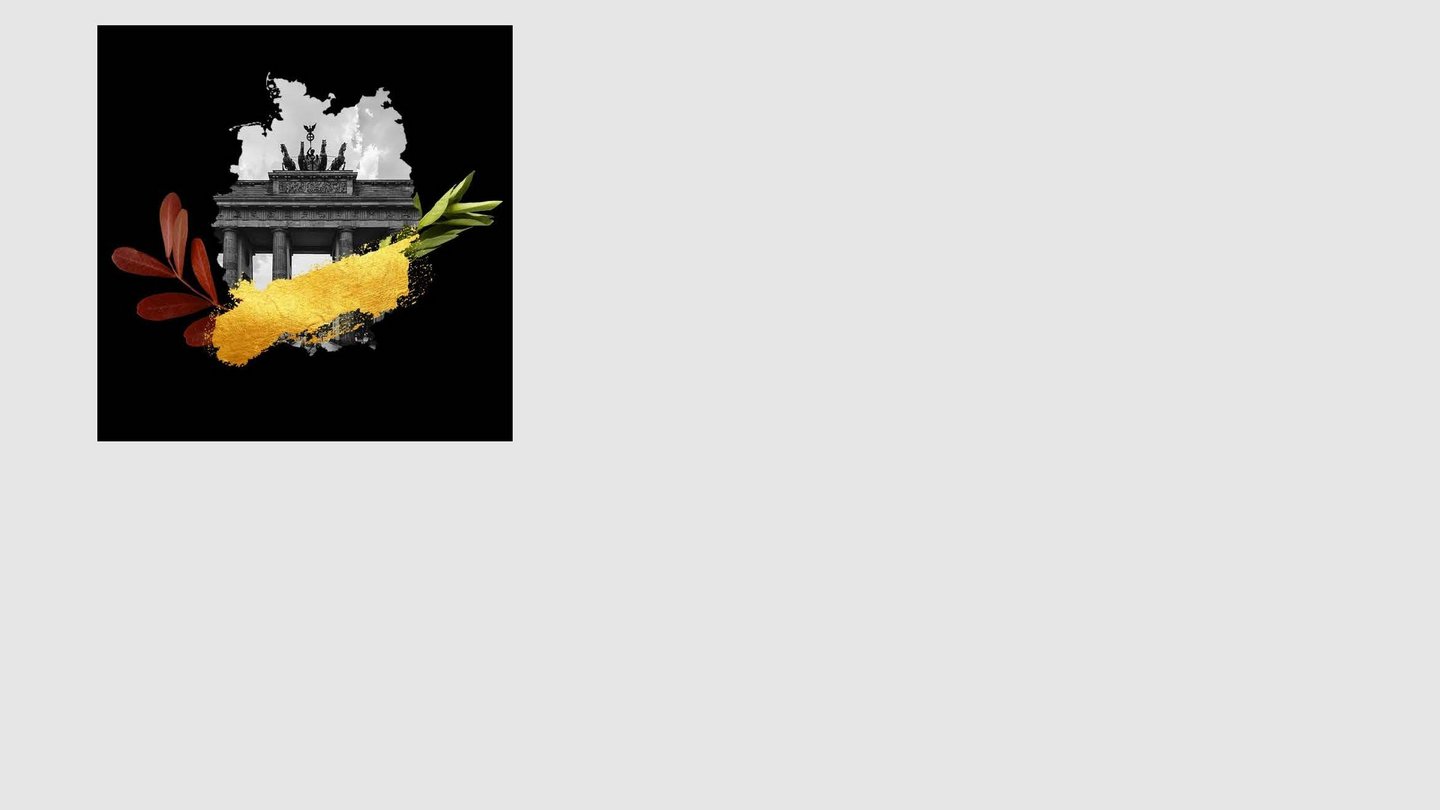
In einer Fernseh-Talkrunde zur Corona-Krise hatte der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder Ende März aufgefordert: „Wer gläubig ist, soll beten, dass es Deutschland nicht zu hart trifft.“ Diesen Appell nahmen Verantwortliche verschiedener kirchlicher und freikirchlicher Organisationen und Institutionen auf und riefen die digitale Aktion „Deutschland betet gemeinsam“ (DBG) ins Leben. In einer Zeit von Kontaktbeschränkungen und Versammlungsverboten sollte damit die Möglichkeit geboten werden, in einer virtuellen Gebetsgemeinschaft „für unser Land“ zu beten, „für Kranke und Gesunde, für alle, die jetzt wichtige Dienste leisten“.
Initiiert wurde DBG von: Gerhard Proß, Mitglied des Leitungskomitees des christlichen Netzwerks „Miteinander für Europa“; Dr. Johannes Hartl, katholischer Theologe und Leiter des Augsburger Gebetshauses; Fadi Krikor, Begründer und Leiter des Tagungs- und Retraite-Zentrums „Father’s House for all Nations“ im Kloster Altenhohenau nahe München; Friedegard Warkentin, (dem „Gebetshaus Augsburg“ nahestehende) Leiterin der Augsburger Therapieeinrichtung Eser 21; Tobias und Frauke Teichen, leitende Pastoren der freikirchlichen ICF-Gemeinde München (International Christian Fellowship), und Julia Warkentin von der (dem ICF nahestehenden) ökumenischen Gebetshaus-Initiative München. Die Liste der offiziellen Unterstützer ist lang. Sie umfasst Namen von kirchlichen und freikirchlichen Funktionsträgern, Politikern, Prominenten aus dem öffentlichen Leben und zahlreichen christlichen Organisationen großenteils aus dem evangelikalen oder pfingstkirchlichen Spektrum.
Am Mittwoch der Karwoche, dem 8. April, wurde das Event zwischen 17.00 und 18.30 Uhr im Internet unter www.deuschlandbetetgemeinsam.de und bei christlichen Fernsehsendern (Bibel.TV, ERF, EWTN TV) aus dem „Gebetshaus Augsburg“ live übertragen. Digital zugeschaltet waren Vertreterinnen und Vertreter aus Kirchen und Freikirchen sowie aus Politik und Gesellschaft, die sich mit Statements zur Kraft des Gebets und/oder mit live gesprochenen Gebeten zur aktuellen Krise beteiligten.
Eröffnet wurde die Sendung vom Bayerischen Ministerpräsidenten, der auch die Schirmherrschaft übernommen hatte. Es folgten Beiträge der Initiatoren (s.o.), außerdem von: Peter Maffay, Musiker; Stefan Oster, Bischof von Passau; Prinz Philip Kiril von Preußen, Pastor; Jana Highholder, „Sinnfluencerin“ der EKD; Maite Kelly, Sängerin; Dr. Kristina Schröder, ehemalige Bundesfamilienministerin; Dr. Dorothea Greiner, Regionalbischöfin des evangelischen Kirchenkreises Bayreuth; Dr. Bertram Meier, ernannter Bischof von Augsburg; Dr. h.c. Frank Otfried July, Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg; Axel Pieper, Regionalbischof des evangelischen Kirchenkreises Augsburg; Serafim Joantă, Rumänisch-Orthodoxer Erzbischof und Metropolit für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa. Zwischen den Beiträgen wurden live Lobpreislieder dargeboten und das Musikvideo eines Gebetshaus-Segenssongs eingespielt.
Die Initiatoren zeigten sich „überwältigt“ von der Resonanz der Sendung. Es habe rund 250.000 Zugriffe im Internet gegeben; noch einmal rund 250.000 Menschen hätten die Übertragung im Fernsehen verfolgt. Angesichts dieses Erfolges entschlossen sich die Veranstalter sogleich zu einer Fortsetzung: Ab dem 15. April wird bis auf weiteres täglich um 19 Uhr eine digitale Gebetsstunde aus dem „Gebetshaus Augsburg“ live „gestreamt“.
Überblickt man die Riege der Beteiligten, wird man summarisch sagen können, dass es sich um eine Initiative von konservativen Christen unterschiedlicher Herkunft und „Färbung“ handelt, vor allem von Katholiken und Protestanten mit teils mehr traditioneller, teils mehr evangelikaler oder charismatischer Frömmigkeit. Diese mehrheitlich „konservativen“ Christen – freilich ein grober, schillernder und erläuterungsbedürftiger Begriff – versammelten sich in einer Notsituation des eigenen Landes, um für dieses Land zu beten. Sieht man vom atheistischen Standpunkt ab (https://www.awq.de/2020/04/deutschland-betet-gemeinsam-analyse-einer-evangelikalen-pr-aktion/), so erscheint dieses Anliegen an sich unproblematisch. Trotzdem wurde es schon im Vorfeld verschiedentlich problematisiert.
1. Die Kritik entzündete sich erstens an der nationalen Ausrichtung der Aktion: „Deutschland betet gemeinsam“. So wurde von dem WDR-Journalisten Arnd Henze bemängelt, ein ausschließliches Gebet für das eigene Land sei angesichts einer globalen Katastrophe eine nicht nachvollziehbare Engführung. In eine ähnliche Richtung ging der Verdacht des Journalisten Philipp Greifenstein vom Online-Magazin „Die Eule“, in der „schwarz-rot-goldenen Ästhetik“ des Events komme eine fragwürdige Ideologie zum Ausdruck: „Feiert hier ein nationales Christentum im Schatten der Krise ein Comeback?“ (https://eulemagazin.de/deutschland-betet-fuer-das-juengste-gericht/) Daraufhin wurde von den Veranstaltern der Gebetsaufruf dahingehend ergänzt, dass auch „für unseren Kontinent und alle Menschen weltweit, die von der Krise betroffen sind“, gebetet werden solle.
Von Henze wurde außerdem vorgebracht, es werde mit dem Slogan „Deutschland betet gemeinsam“ ein überzogener Repräsentanzanspruch angemeldet. Mag man diesen Vorwurf auch als kleinlich erachten und mit Berufung auf die Freiheiten werbewirksamer Überspitzung abweisen – der Sache nach ist Henze natürlich im Recht. Denn: Ein großer Teil Deutschlands betet nicht, auch nicht in der Krise und schon gar nicht gemeinsam. Man darf sich nicht wundern, wenn Vertreter dieses a-religiösen oder anders-religiösen Deutschlands die Vereinnahmung durch eine konservativ-christliche Veranstaltung als anmaßend und übergriffig empfinden. Daher gilt: Auch in der religiösen Begeisterung sollte die Sensibilität für die Reserven der Nicht-Begeisterten oder Anders-Begeisterten nicht verloren gehen.
2. Diese Sensibilität ist von Christen in Deutschland aus den bekannten historischen Gründen ganz besonders im Verhältnis zu jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gefordert. Das trifft auch dann zu, wenn man sich das Anliegen guter jüdisch-christlicher Beziehungen besonders zu eigen gemacht hat. In solchem Ansinnen war DBG von den Initiatoren bewusst auf den Beginn des jüdischen Pessach-Festes gelegt worden, um damit ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Dieses Zeichen schien zunächst auch von jüdischer Seite begrüßt zu werden, fanden sich doch anfangs auf der Liste der Unterstützer – als einzige Vertreter einer nicht-christlichen Religion – die Namen des Landesrabbiners Zsolt Balla von der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland und des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Halle Max Privorozki. Am Tag vor der Sendung ließen beide ihre Namen freilich wieder von der Liste streichen, den Veranstaltern zufolge ohne Angabe von Gründen.
Womöglich war bei den jüdischen Repräsentanten inzwischen ein Eindruck dominant geworden, der zuvor von Kritikern artikuliert worden war: Der Gebetsaufruf von DBG zeige aufgrund seiner Identifizierung der betenden Nation mit dem Volk Israel „antisemitische oder zumindest respektlose Tendenzen“, so der evangelische Theologe Georg Bloch-Jessen. In schärferer Formulierung warf Henze DBG eine „evangelikal-deutschnationalen Kaperung des jüdischen Passahfestes“ vor und interpretierte damit das ursprünglich dezidiert als „prosemitisch“ intendierte Zeichen ebenfalls als eine subtile Form von christlichem Antisemitismus.
Auf diese harschen Vorwürfe hin wurde der Text des Gebetsaufrufs sowie des Gebets auf der DBG-Website entsprechend abgeändert. DBG zeigte sich also erneut kritik- und korrekturfähig. Zudem strich der von DBG zum „theologischen Beirat“ bestellte Theologe Thomas Schirrmacher, stellvertretender Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA), in einer Stellungnahme ausdrücklich heraus, „dass DBG kein Versuch ist, durch die Hintertür jüdische Mitbürger zu vereinnahmen oder zu missionieren, wir wollen mit ihnen gemeinsam zu dem Gott beten, der der Schöpfer und Erretter der Welt ist“ (https://www.thomasschirrmacher.info/blog/stellungnahme-von-thomas-schirrmacher-zum-webbeitrag-ueber-deutschland-betet-gemeinsam-in-die-eule/).
Allerdings wird man auch an diese Klarstellung die Rückfrage stellen dürfen, ob damit dem geforderten Fingerspitzengefühl genüge getan ist. Auch abgesehen von den generellen Schwierigkeiten interreligiösen Betens hätte man im Bewusstsein der historischen Verwerfungen im jüdisch-christlichen Verhältnis von vornherein mit massiven Vorbehalten gegenüber einem gemeinsamen Gebet rechnen müssen. Auch gutgemeinte Zeichen können ungewollt übergriffig wirken. Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass innerhalb der evangelikalen Bewegung, die unter den Unterstützern von DBG überaus stark repräsentiert ist, immer noch eine deutliche Tendenz zur Bejahung der Judenmission herrscht. Es wäre mehr als nachvollziehbar, wenn Vertreter des Judentums den Vorschlag eines Gebets in solcher Gemeinschaft als Zumutung empfänden.
3. Damit ist ein schwieriges Problem berührt, das DBG mit anderen Gemeinschaftsinitiativen teilt, nicht zuletzt in der Ökumene: das Problem der Mithaftung von Veranstaltern für die innerhalb oder außerhalb der gemeinsamen Veranstaltung geäußerten Ansichten von Mitveranstaltern oder offiziellen Unterstützern. Wie weit reicht die Identifikation von DBG mit den unterschiedlichen Positionen seiner Unterstützer? Wie weit können diese Positionen dem Projekt zugeschrieben werden? Wie intensiv hätte DBG prüfen müssen, wie sich die Beteiligten zu verschiedenen Themen positionieren? Und: Wie weit kann den Initiatoren zugerechnet werden, was die Beteiligten in live-Übertragungen von sich geben?
„DBG ist kein deutschlandweiter theologischer Gerichtshof, der alle Beteiligten zunächst einer intensiven Recherche und Beurteilung unterzieht. Wer auch sonst mit Christen aller Art zusammen arbeitet und das gemeinsame Glaubensbekenntnis der Kirchen teilt, ist herzlich eingeladen, mitzubeten und auch Ideen einzubringen“, so hat Schirrmacher im Namen von DBG geschrieben. In der Tat: Wer eine breit angelegte ökumenische Unternehmung betreibt, intendiert Gemeinschaft trotz positioneller Differenz, auf der Grundlage einer die Differenz überschreitenden, fundamentaleren Einheit. Das geht nur mit der Bereitschaft zu einer gewissen Toleranz gegenüber abweichenden, womöglich auch schwer zu ertragenden Positionen. Zugleich muss es natürlich auch Grenzen der theologischen Toleranz und Grenzen der ökumenischen Gemeinschaft geben. Aber wer zieht für wen diese Grenzen? Noch dazu bei einem relativ kurzfristigen ökumenischen Vorhaben in einer Krisensituation? Hiermit sind schwierigste Fragen der Gewichtung von Übereinstimmung und Widerspruch, von Identität und Differenz aufgeworfen. Unterschiedliche Kriterien für eine solche Gewichtung machen jedes ökumenische Projekt angreifbar – je breiter es angelegt ist und je weiter sein öffentlicher Anspruch und seine öffentliche Resonanz reichen, desto mehr. Fest steht auch: Wer dazu neigt, die Grenzen des Tolerablen allzu eng zu ziehen, taugt nicht zum Ökumeniker. Er oder sie sollte es sich dennoch mit der Kritik an der konkreten Ökumene nicht zu leicht machen.
Man muss das benannte Grundproblem ökumenischer Arbeit berücksichtigen, will man die Kritik an DBG bewerten, die sich auf Äußerungen einzelner Teilnehmer bezieht. So hat Greifenstein DBG einige Aussagen Fadi Krikors vorgehalten, in denen er eine christliche „Endzeitideologie“ erkennt. Man hätte bei den evangelikalen oder charismatischen Unterstützergruppierungen ohne weiteres ähnliche Ausführungen finden können, wohl auch solche, die einen radikaleren apokalyptischen Geist atmen. Was Greifenstein anführt, wirkt innerhalb des Spektrums christlicher Apokalypse-Phantasien doch recht harmlos, zumal Krikor keine apokalyptische Ausmünzung der Corona-Krise selbst vornimmt. Wer hier schon Alarmglocken schrillen hört, hat offenkundig wenig ökumenische Erfahrung.
Auch innerhalb der live-Übertragung des Gebetsevents lassen sich Äußerungen namhaft machen, die auch wohlgesonnene Mitbeterinnen und Mitbeter befremdet haben mögen. So war bei Philip Kiril von Preußen, Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, Brandenburger Pfarrer und entschiedener Abtreibungsgegner, herauszuhören, dass er seinen Auftritt bei DBG als Forum für die eigenen ethisch-religiösen Zentralanliegen nutzte: „Ich stelle mir vor: Gott schmerzt es besonders, dass wir die Ehrfurcht vor der Würde des Lebens an sich oftmals abgelegt haben. Und noch mehr natürlich, dass viele sich für Gott selbst kaum noch interessieren.“ Wer sich fragte, wie diese Gebetsanliegen zu einer Gebetsaktion in der Corona-Krise passen, erhielt sogleich Antwort: Die Krise biete, so von Preußen, auch etwas Gutes, nämlich die Chance zur Besinnung und Umkehr.
Auch andere Beter bedienten den Topos von der „Krise als Chance“, neben Krikor beispielsweise der rumänisch-orthodoxe Metropolit Serafim, bei dem besonders viel von Sünde und Umkehr die Rede war. Kritiker werteten diese Appelle als Versuch, religiöses Kapital aus den Ängsten der Menschen zu schlagen, und erblickten darin einen „missionarischen Missbrauch der Krise“ (Henze). Dies ließe sich auch in eine schwerwiegende Anfrage an das überkommene Christentum überhaupt wenden. Neigt es mit seiner konstitutiven Rede von menschlicher Sünde und göttlicher Erlösung nicht grundsätzlich dazu, an die negativen Erfahrungen der Menschen anzuknüpfen und sich somit grundsätzlich als „Krisen-Gewinnler-Religion“ zu präsentieren? Wie wäre zu unterscheiden zwischen einem legitimen und einem missbräuchlichen Anschluss an die menschlichen Krisensituationen? Vermutlich macht auch hier der Ton die Musik. Sobald sich ein Unterton der Genugtuung über den christlichen Relevanzgewinn in der Notsituation einschleicht, wird es unangenehm.
Aber wie dem auch sei – immerhin hat weder Serafim noch ein anderer der Beiträger die Pandemie als Strafe Gottes gedeutet. Der Metropolit hat eine derartige Deutung sogar ausdrücklich abgewiesen. Diese theologische Grenze jedenfalls hat keiner der Beteiligten überschritten. Je nach theologischer Präferenz ist freilich die Kritik an anderen Grenzüberschreitungen erlaubt und geboten. Solche Kritik sollte aber nicht unmittelbar auf die Aktion und ihre Initiatoren gerichtet werden. Es sei denn, man verbindet damit ein Bekenntnis zur Verzichtbarkeit solcher ökumenischen Veranstaltungen. Dafür lassen sich gute Gründe angeben, insbesondere die Wahrung der Reinheit der je eigenen religiösen bzw. theologischen Option. Man muss sich dabei aber der religionspolitischen Folgekosten bewusst sein. In diesem Sinne kann man DBG auch als Exerzitium für religiös-weltanschauliche Toleranz in einer pluralistischen Gesellschaft begreifen – und befürworten.
4. Dies schließt wohlgemerkt nicht aus, sondern ein, dass gelebte Toleranz immer auch weh tut – ich muss den anderen ja trotz des von mir Abgelehnten „ertragen“ (lat. tolerare). Will man die wesentlichen Punkte der Kontroverse aufführen, so darf auch ein (mehr oder weniger) unausgesprochener, aber umso fundamentalerer Aspekt der Ablehnung nicht unerwähnt bleiben, der in der Debatte überall mitschwingt: Wie schon mehrfach angeklungen ist, spielen Fragen der theologischen Grundausrichtung und der religiösen Grundgestimmtheit in dem Streit eine zentrale Rolle. Wie gesagt: DBG ist unübersehbar eine Aktion christlich-konservativer Tönung. Dies ruft bei Christinnen und Christen anderer Prägung Widerstände hervor.
So schwer das für „bibeltreue“ Christen vorstellbar ist: Nicht für jedermann ist die Reflexion auf Sünde und Umkehr wirklich ein zentrales Element der eigenen Frömmigkeit. Und nicht für jede Frau hat das Gebet den zentralen Stellenwert, der ihm von den meisten Protagonisten von DBG mit großer normativer Gewissheit zugewiesen wird. Schirrmacher unterstreicht für sich und die Seinen „den Glauben, dass Gebet ein reales Gespräch zwischen Personen ist und unser Schöpfer und Erretter uns zuhört, wenn wir mit ihm sprechen“, und er hält es dem DBG-Kritiker Greifenstein recht unfreundlich vor, dieses traditionelle Stück christlicher Frömmigkeit nicht mit gleicher Entschiedenheit zu bejahen. Aber wäre nicht auch von den „Frommen“ etwas mehr Verständnis für die Zeitgenossen zu erwarten, bei denen das Bewusstsein vom unvermeidlichen Anthropomorphismus der Behauptung eines „realen Gesprächs zwischen Personen“ verhindert, dass sie sich zu einem derart unproblematischen Verhältnis zum Beten „aufraffen“ können? „Beten tröstet und hilft die Gedanken sammeln. Vielleicht auch noch mehr“, so Greifenstein. „Wenn das alles ist, muss natürlich eine solche Gebetsinitiative an sich schon suspekt sein“, entgegnet Schirrmacher. Dieser Wortwechsel markiert treffend die religiös-theologische Grunddifferenz, die den Kern des Streites ausmacht. Solange die theologischen und religiösen Lager einander nicht mehr Respekt und Toleranz entgegenzubringen bereit sind, werden wir uns immer munter weiterstreiten.
Die besagte Grunddifferenz hat aber wohl noch eine Tiefendimension, die sich noch schwerer benennen und daher auch noch schwerer entschärfen lässt als die angesprochenen Streitpunkte. Es gibt Christen, die es als große religiöse Geschmacklosigkeit, ja: als Entweihung empfinden, wenn die Hymne „Großer Gott, wir loben dich“ – wie in der DBG-Übertragung geschehen – im Lobpreislied-Duktus erotisch angehauchter Lovesong-Innigkeit dargeboten wird. Andere freuen sich an der ästhetischen Aktualisierung eines „verstaubten“ Klassikers und gehen innerlich voll mit – endlich hat ihnen der alte Choral auch etwas zu sagen. Solche religiösen Stil- und Geschmacksdifferenzen sind in ihrer Konfliktpotenz kaum zu unterschätzen. Und weil die betreffenden Reaktionen auf der Ebene intuitiv-affektiver Resonanz angesiedelt sind, weshalb sie nahe an Ekel oder umgekehrt an Verzückung heranreichen können – man „hält es einfach nicht aus“ oder man „fährt voll drauf ab“ –, darum ist im Falle der Aversion auch die Toleranz besonders schwierig. Und selbst wenn es mir gelingt, den fremden Stil trotz meiner heftig widerstrebenden Gefühle als legitimen Ausdruck des gemeinsamen Glaubens anzuerkennen, ist damit noch nicht gesagt, dass ich diesen Ausdruck selbst authentisch mitvollziehen kann. Wer ein freies Gebet, das durch die geschlossenen Augen der Beterin und sprachliche Signale inniger Nähe zu Gott größte religiöse Innerlichkeit bekundet, in seiner Diskrepanz zur maximalen Öffentlichkeit der digitalen Massenübertragung als etwas Widriges empfindet, der kann womöglich – widerstrebend – einräumen, dass das für andere eine religiös glaubwürdige Form sein mag; selbst mit echter Anteilnahme mitzubeten wird er oder sie nicht in der Lage sein. Die Möglichkeit echter religiöser Gemeinschaft von verschieden Geprägten stößt in solchen tief empfundenen Diskrepanzen des religiösen „Geschmacks“, des Sinnes für die angemessene, stimmige Form, an nahezu unüberwindbare Grenzen. Auf dieser Ebene gemeinsamer religiöser Praxis ist ein Fortschreiten der Ökumene daher weit weniger machbar und steuerbar als auf der Ebene theologischer Konsenspapiere.
Aber müssten derartige Empfindlichkeiten nicht wenigstens in der Situation kollektiver Not überwindbar sein? Das Resümee der Debatte fällt zwiespältig aus. Vieles wurde sehr zu Recht kritisiert. Aber selbst wenn man die Grundausrichtung und die Formen von DBG nicht teilt und wenn man sich das Projekt Ökumene selbst nicht zu eigen machen will, wird man der Aktion und ihren Initiatoren für ihr ökumenisches Projekt doch grundsätzlich Anerkennung zollen. Man muss ja selbst nicht mitbeten. Dass es den Veranstaltern gelungen ist, in einer Zeit geschlossener Kirchen viele Menschen zum Mitbeten zu bewegen, ist gleichwohl respektabel.
Martin Fritz
Ansprechpartner
 PD Dr. theol. Martin Fritz
PD Dr. theol. Martin FritzAuguststraße 80
10117 Berlin
