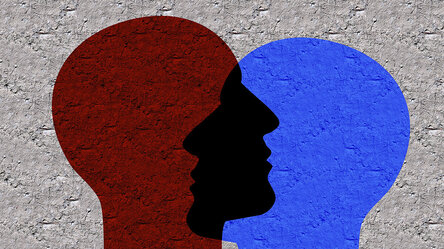Zum Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit (UEM)
„Antimuslimischer Rassismus“ als Radikalisierungsfaktor

Hinweis: Der folgende Beitrag wurde im Januar 2024 für die ZRW eingereicht und nimmt daher auf die durch einen Gerichtsentscheid veranlasste vorläufige Zurücknahme und Überarbeitung des UEM-Berichts durch das BMI im März 2024 keinen Bezug.
Nach dem fremdenfeindlichen Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020 berief das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) im September 2020 den Unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit (UEM) ein und versah ihn mit dem Auftrag, sich eingehender mit den Ausdrucksformen, Wirkungsweisen und der Bekämpfung der seit 9/11 kontinuierlich anwachsenden Islam- bzw. Muslimfeindlichkeit in der deutschen Bevölkerung zu befassen. Der mit Wissenschaftlern und Akteuren zivilgesellschaftlicher Organisationen besetzte Expertenkreis erarbeitete in rund neunzig Sitzungen (Plenum, Arbeitsgruppen und Expertengespräche) einen Bericht, der am 30. Juni 2023 unter dem Titel „Muslimfeindlichkeit. Eine deutsche Bilanz 2023“1 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Bericht greift auf fünf bundesweite Studienreihen zurück, die seit Beginn des Millenniums alle ein bis drei Jahre muslimfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung messen und so belastbare Daten zu diesem Themenkreis liefern.2
Der UEM-Bericht und seine Verdienste: Grundlegungen zur Datenlage
Muslimfeindlichkeit als Phänomen der gesellschaftlichen Mitte
Das Ergebnis des Berichts mag nicht überraschen, und doch ist es das große Verdienst des UEM, das Phänomen Muslimfeindlichkeit und dessen Ausmaß erstmals umfassend auf eine solide Datenbasis gestellt zu haben. Dieser Datenbasis zufolge ist Muslimfeindlichkeit in West- und Ostdeutschland gleichermaßen stark ausgeprägt, gedeiht in der Mitte der Gesellschaft und stellt für viele Muslime eine Alltagsrealität dar, die ihr psychisches Wohlbefinden zum Teil erheblich beeinträchtigt. Muslime werden dem UEM-Bericht zufolge nicht nur als besonders „fremde“ Zuwanderer wahrgenommen. Im Zusammenhang mit der Migrationspolitik wird ihnen als Angehörigen einer angeblich „rückständigen“ Religion von jedem/jeder zweiten Deutschen eine mangelnde Integrationsfähigkeit sowie eine bewusste Abgrenzung gegenüber Andersgläubigen unterstellt. Die im Rahmen des „Religionsmonitors“ erfassten Daten zeigen, dass sich das Negativbild des Islam in Deutschland mittlerweile verfestigt hat: Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung (52 Prozent) betrachtet den Islam als „(sehr oder eher) bedrohlich“.3 Über die Hälfte der Befragten (54 Prozent) sind der Meinung, der Islam sei „in erster Linie“ eine politische Ideologie.4 Und in Ostdeutschland geben 55 Prozent, in Westdeutschland 45 Prozent der befragten Personen an, sich „durch die vielen Muslime […] wie ein Fremder im eigenen Land“ (UEM, 24) zu fühlen.
Die islambezogenen, mit Gewaltaffinität, Extremismus, Patriarchalismus und Rückständigkeit verknüpften Assoziationsketten offenbaren eine erhebliche Wirkmacht: Dass „Muslimen die Einwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte“, finden seit Erfassung dieses Items immer mehr Menschen; inzwischen liegt die Zustimmung je nach Umfrage zwischen 32 und 44 Prozent (gegenüber 21,7 Prozent im Jahr 2003). Die Forderung nach einer Einschränkung der Religionsfreiheit für Muslime wurde 2012 von 32 bis 46 Prozent, im Jahr 2016 von 49 Prozent der Befragten zustimmend quittiert. Doch nicht nur in Deutschland ist das Misstrauen gegenüber Muslimen bzw. der Anteil derer, die Muslimen pauschal „gar nicht“ oder „wenig“ vertrauen, mit 41 Prozent relativ hoch: Ähnliche Zahlen zwischen 35 und 41 Prozent begegnen auch in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Österreich (vgl. UEM, 55). Zugleich fällt eine nur beiläufig referierte, im Bericht aber nicht eigens reflektierte Beobachtung ins Auge, die die Differenz zwischen dem Anteil pauschaler Vorbehalte gegenüber dem Islam als Religion einerseits und den Muslimen andererseits betrifft: Die Ablehnung muslimischer Zuwanderer und Schutzsuchender erfolgt „nicht aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit“, sondern „aufgrund eines Fundamentalismusverdachts“ (UEM, 58). Der mögliche Schluss, dass die Vorbehalte gegenüber dem Islam insbesondere diesem Verdacht, nicht aber einer allgemeinen Religionsfeindlichkeit geschuldet sind, bliebe auch für ein adäquates Verständnis der von den GMF-Surveys als „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ bezeichneten Muslimfeindlichkeit nicht ohne Konsequenz.
Staatliche Maßnahmen, Betroffenenperspektive und Empowerment
Mit dem 2015 eingesetzten Bundesprogramm „Demokratie leben“ hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) den Phänomenbereich „Islam- und Muslimfeindlichkeit“ erstmals gesondert in den Blick genommen. Über die seitdem geförderten Modellprojekte ist mittlerweile die Grundlage für eine eigenständige pädagogische Fachpraxis im Handlungsfeld der politischen Bildung geschaffen worden. Deren Ziel ist es, jüdischen, muslimischen und anderen religiösen Gemeinschaften dabei zu helfen, in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft als religiöse Akteure sichtbarer zu werden. Die im Kontext der Islamismus- bzw. Radikalisierungsprävention vorgenommene Thematisierung und Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit impliziert jedoch ein Problem, wie der UEM-Bericht kritisch vermerkt: Sie trägt ungewollt zur „Perpetuierung des Topos von gewaltbereiten Muslim*innen“ (UEM, 156) bei und führt somit insbesondere in schulischen Präventionsprogrammen gegen Islamismus auch zu kontraintentionalen Effekten. Die von Präventionsprogrammen beabsichtigte Stärkung muslimisch markierter Jugendlicher geht mit sogenannten Othering-Prozessen einher, d. h. mit der „gewaltvollen Herstellung bestimmter Menschen als ‚Andere‘“ (UEM, 157).
Auf dieses Problem hat auch das seit 2020 öffentlich geförderte Kompetenznetzwerk Islam- und Muslimfeindlichkeit aufmerksam gemacht. Es besteht aus den zivilgesellschaftlichen Trägern Teilseiend/CLAIM, dem Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur, dem Verband binationaler Familien und Partnerschaften sowie der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend und setzt sich zum Ziel, „muslimfeindlich motivierte Übergriffe und Diskriminierung besser zu erfassen und sichtbar zu machen“ (UEM, 73). Als wichtiger Akteur dieses Netzwerks hat die NGO CLAIM, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie von der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Gleichstellung gefördert wird, Anfang 2023 eine Studie zu „Erfahrungen und Umgangsstrategien von Betroffenen von antimuslimischem Rassismus“5 durchgeführt, die im Rahmen einer halbstandardisierten Online-Umfrage und leitfadengestützter Tiefeninterviews insgesamt 740 Personen auf ihre Erfahrungen mit antimuslimisch motivierter Diskriminierung befragte. Demnach sind 80 Prozent der Befragten von einer oder mehreren Formen von „antimuslimischem Rassismus“ (AmR) betroffen bzw. leiden unter einer subtilen, indirekten Muslimfeindlichkeit, die sich aus der Gleichsetzung des Islam mit Terror und Extremismus (70 Prozent) und der negativen Darstellung des Islam in den Medien (69 Prozent) ergibt.
Zu der „am stärksten von AmR betroffene[n] Gruppe“, so formuliert es auch der UEM-Bericht, zählen insbesondere „Personen, die sich als religiös beschreiben, Teil einer muslimischen Organisation sind oder religiös konnotierte Kleidung tragen“, bzw. „Muslim*innen, für die ihre Religion sichtbar wichtig ist“ (UEM, 132). Sie erleben den im Internet und in den sozialen Netzwerken erfahrenen AmR zumeist auf einer intersektionalen Ebene als Mehrfachdiskriminierung, die Herkunft, Sprache, Aussehen und Religion gleichermaßen umfasst: Als explizite Gründe für die Diskriminierung werden die ethnische Herkunft (65 Prozent), das Aussehen (57 Prozent), die religiöse Kleidung (53 Prozent), der Name (50 Prozent) und die religiöse Praxis (44 Prozent) benannt. Angesichts der pauschalen Verknüpfung des Islam mit „Extremismus und Rückständigkeit“, die Muslimen eine Affinität zu Gewalt und patriarchalen Überzeugungen unterstellt, erleben sie sich von einer besonderen Stigmatisierung betroffen, die sich im öffentlichen Raum und insbesondere auch in den Schlüsselbereichen „Bildung, Arbeitswelt und Wohnungsmarkt“ (UEM, 8) äußert. Die damit verbundenen Mikroaggressionen und Ausgrenzungserfahrungen können eine Form von Stress verursachen und zu einem Vermeidungsverhalten führen, das den Stress nochmals erhöht.6 Bildungsträger und -angebote, die sich nun explizit mit AmR und dessen Bekämpfung beschäftigen, gehen daher auch ausdrücklich auf Distanz zu stigmatisierenden Präventionsrhetoriken und lassen sich, ebenfalls durch Bundesmittel finanziert, als sogenannte Empowerment-Angebote verstehen: Diese Angebote greifen in Distanzierung von Ansätzen interkultureller Pädagogik vornehmlich Rassismustheorien auf und suchen in ihren Workshops, wie der Bericht vermerkt, zum Abbau von Vorurteilen „auch ‚beruhigendes‘ Wissen über Muslim*innen und den Islam zu vermitteln“ (UEM, 157). Grundlegend sei Muslimfeindlichkeit, anstatt sie im Kontext der Prävention zu verorten, als „eigenständige Ideologie der Ungleichwertigkeit“ (UEM, 10) zu erfassen.
Sehr umfangreich und fast allumfassend: Die Handlungsempfehlungen
So umfassend der UEM-Bericht das Ausmaß an Muslimfeindlichkeit und die Perspektive der von ihr Betroffenen zur Sprache bringt, so umfangreich ist auch die Liste der Handlungsempfehlungen, die er der Gesellschaft und der Politik zu deren Bekämpfung ans Herz legt. Von den zwanzig empfohlenen Maßnahmen, die der Bericht gleich zu Beginn (UEM, 16–18) zusammenfasst, seien hier exemplarisch nur die folgenden erwähnt: eine umfassende Gewährleistung des Schutzes von Muslim*innen „im gesamten öffentlichen Raum“ (Nr. 1) und „die Ernennung einer*eines Bundesbeauftragten für die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit“ (Nr. 3), „die Etablierung von rassismuskritischen, diversitäts- und religionssensiblen Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Berufsgruppen und in allen staatlichen Einrichtungen“ (Nr. 5) sowie der „Auf- und Ausbau von Beschwerde-, Melde- und Dokumentationsstellen und von Antidiskriminierungs- und Beratungsstellen mit Expertise zu Muslimfeindlichkeit“ (Nr. 6), eine „fächerübergreifende Überarbeitung der Lehrpläne und Schulbücher, um darin enthaltene muslimfeindliche Inhalte zu streichen und eine kritische Auseinandersetzung mit muslimfeindlichen Positionen und Narrativen zu gewährleisten“ (Nr. 8), eine an „rassismuskritische und intersektionale Ansätze“ angelehnte „Etablierung von qualitativen Standards in der politischen Bildung“ (UEM, 168; vgl. Nr. 9), „die Anerkennung des Verbots der mehrdimensionalen und intersektionalen Diskriminierung und die Überführung in die Rechtspraxis“ (UEM, 134) sowie „eine verbesserte Medienkompetenzschulung im Bereich Muslimfeindlichkeit“ (Nr. 16), schließlich der Ausbau einer „systematischen Dokumentation von muslimfeindlichen Einstellungen und Praktiken bei Polizei-, Sicherheits- und anderen Behörden“ (Nr. 18) „auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle“ (UEM, 77).
Nachvollziehbarkeit und Nutzen der vom UEM-Bericht genannten Handlungsempfehlungen mögen angesichts des geschilderten Ausmaßes an Muslimfeindlichkeit in der Gesellschaft nicht zur Debatte stehen. Doch sosehr man in der Vielzahl und Vehemenz der vorgetragenen Handlungsempfehlungen eine Stärke des UEM-Berichts sehen mag, sosehr lassen sie die berechtigte Frage aufkommen, ob damit dem Anliegen einer nachhaltigen Bekämpfung der Diskriminierung von Muslimen wirklich geholfen ist. Würde eine jede sich als diskriminiert und rassifiziert empfindende Minderheit mit einem ähnlich umfassenden Maßnahmenprogramm vor möglichen und realen Anfeindungen geschützt werden wollen, hätte dies für das kritische gesellschaftliche Mit- und Gegeneinander in einer religiös, weltanschaulich und kulturell heterogenen Einwanderungsgesellschaft wie Deutschland erhebliche Konsequenzen. Zur Konkretisierung des hier zur Sprache gebrachten Vorbehalts gilt es im Folgenden, die im UEM-Bericht vorgenommene Verwendung der Begriffe und Konzepte „Muslimfeindlichkeit“ und „Rassismus“ nochmals ausführlicher zu beleuchten.
Kritische Anfragen zum UEM-Bericht: Konzeptionelle Präzisierungen
Begriffe – Muslimfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus
Nach der Arbeitsdefinition des UEM bezeichnet „Muslimfeindlichkeit“ „die Zuschreibung pauschaler, weitestgehend unveränderbarer, rückständiger und bedrohlicher Eigenschaften gegenüber Muslim*innen und als muslimisch wahrgenommenen Menschen“. Die dadurch bewusst oder unbewusst konstruierte „Fremdheit oder sogar Feindlichkeit“ führe, so der Bericht weiter, „zu vielschichtigen gesellschaftlichen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozessen, die sich diskursiv, individuell, institutionell oder strukturell vollziehen und bis hin zu Gewaltanwendung reichen können“ (UEM, 7). Über „Prozesse der Rassifizierung“ werden „scheinbar gegensätzliche Gruppen konstruiert und in einer Logik der Wir-Sie-Unterscheidung hierarchisch zueinander positioniert“ (UEM, 23). Weil es den Begriffen „Muslim-“ und „Islamfeindlichkeit“ aber „an Erklärungskraft für strukturelle und institutionelle Formen von Muslimfeindlichkeit fehlt“ (UEM, 26), werden Konzepte wie Muslimfeindlichkeit und „antimuslimischer Rassismus“ (AmR) „gleichwertig“ bzw. „synonym“ verwendet und vor dem Hintergrund einer „Theorie des antimuslimischen Rassismus“ erschlossen. Damit ist auf die mögliche Frage, warum sich der Bericht nicht mit dem Begriff „Muslimfeindlichkeit“ begnügt und neben diesem auch den des „AmR“ verwendet, eine kurze und scheinbar prägnante Antwort gegeben.
Doch hätte gerade an dieser Stelle die genannte Theorie ebenso wie der Begriff selbst eine konkretere inhaltliche und systematische Bestimmung erfahren können – dies auch, um dem Eindruck zu wehren, hier würden Bestandteile unterschiedlicher Diskriminierungsideologien und -praktiken ohne Begründung auf das als „Rassismus“ Bezeichnete übertragen. Scheinbar selbsterklärend wird in Anknüpfung an die „neuere Rassismusforschung“ festgestellt, dass das „Andere“ „erst sozial hergestellt“ und „dann zwischen ‚Wir‘ und den ‚Anderen‘ unterschieden“ (UEM, 28) wird. Aus sozialpsychologischer Perspektive ist dies jedoch noch eine sehr allgemeine, nicht zwingend auf Rassismus verweisende Feststellung. Die mit sozialen Verhältnisbestimmungen verbundenen Prozesse der Identitätskonstruktion und -produktion setzen immer schon unhintergehbar eine Abgrenzung des (fraglos eine Konstruktion bleibenden) „Eigenen“ vom „Anderen“ voraus. Die Rede von einer „dominanten“ Gruppe, die eine andere Gruppe aus einem kollektiven „Wir“ ausschließt, muss somit noch nicht zwingend rassistisch sein, sofern sie sich eben auf nahezu alle (unhintergehbar zum Menschsein gehörenden) Vorurteile anwenden lässt. Mit Vorurteilen sind bestimmte strukturelle Funktionen der (bewussten oder unbewussten, jedenfalls immer zunächst vorläufigen) Hierarchisierung, Dichotomisierung und Essentialisierung verbunden, die eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung dafür sind, eine Einstellung oder Handlung nachvollziehbar als „rassistisch“ zu qualifizieren. Sosehr Exklusion, Ausgrenzung und Diskriminierung die Würde des Menschen verletzen mögen, sie gewinnen erst dann eine „rassistische“ Signatur, wenn sie als statisch, nicht veränderbar und damit gleichsam unentrinnbar begriffen werden. Insofern dies aber nicht bei allen vom UEM-Bericht beschriebenen Phänomenen in extenso tatsächlich der Fall ist, hätte der Begriff des „Rassismus“, möchte man ihn nicht auf alle Diskriminierungsformen gegenüber Gruppen anwenden, einer weiteren inhaltlichen Präzisierung und Eingrenzung bedurft. Eine solche wird durch die synonyme Verwendung von „Muslimfeindlichkeit“ und „AmR“ eher erschwert als befördert.
Konzeptionen – Zur Diskursivität und Kontextualität von Rassismus
Die im UEM-Bericht erstmals so eindrücklich zur Sprache kommende Notwendigkeit eines analytisch verschärften und kritischeren Blicks auf das Phänomen kulturessentialistischer Schließungen ist mit dieser Kritik keineswegs in Abrede gestellt. Ganz im Gegenteil: Es ist ja nicht die zum „Kulturalisierungsregime“7 gehörende essentialistische Schließung selbst, die der Bericht aufzudecken sucht, sondern vielmehr dessen allerorts und insbesondere in den letzten Jahren zu beobachtende Radikalisierung. Zu einer noch trennschärferen Analyse dieser sich in der pluralen Einwanderungsgesellschaft zweifellos zuspitzenden Problematik von Radikalisierung, der mit ihr verbundenen „Rassifizierung“ sowie der sie aus emischer Perspektive begründenden Motivations- und Gemengelage hätte möglicherweise eine etwas breitere Einbettung der vom UEM-Bericht verwendeten Begriffe und Konzepte in die aufgerufene, tatsächlich von höchst disparaten Ansätzen geprägte Rassismusforschung verhelfen können. Während zum Beispiel der französische Philosoph Étienne Balibar in den 1990er Jahren von einem als „Rassismus ohne Rassen“ zu verstehenden „Neorassismus“ sprach, der nicht mehr biologische Differenzen, sondern „die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenz“8 zur Grundlage seiner Abwertung macht, warnte der britische Soziologe Robert Miles mit Blick auf die Rede vom „Neorassismus“ vor einer „Überdehnung des Begriffs“,9 unterstrich die „Kontinuität“ (continuity) des Rassismus und verstand die von Balibar herausgestellten, vermeintlich neuen Bestandteile des nun kulturalistisch verstandenen Rassismus als dessen wesentliche Konstanten. Der japanischstämmige Literatur- und Kulturwissenschaftler Arata Takeda wiederum ging zum Begriff „Rassismus“ gänzlich auf Distanz, ersetzte ihn durch „Kulturalismus“10 als Bezeichnung „für eine Denk- und Handlungsstruktur“, die „an der Dominanz der eigenen Kategorie interessiert“ ist, und schlug vor, zwischen einem „abwertenden“, „strukturellen“ und „wohlwollenden“ Kulturalismus zu unterscheiden.11 Schon an diesen drei Positionen wird deutlich, wie vielschichtig der immer auch von Intentionen und Interessen geprägte Diskurs zum „Rassismus“ ist: Sobald der enge, auf die Rassentheorien und -ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts beschränkte Begriff auf soziale Dominanzverhältnisse hin geweitet wird, wie es im UEM-Bericht geschieht,12 ist man zugleich zu einer Präzisierung und Neubeschreibung des Gemeinten gezwungen. Das gilt insbesondere für den Kontext europäischer Zuwanderungsgesellschaften, in denen sich in Reaktion auf die Dynamiken der Postmoderne, die von Globalisierung, Digitalisierung und kultureller Pluralisierung gekennzeichnet sind und zugleich Orientierungslosigkeit befördern, nicht nur individuelle, sondern eben auch kommunitäre „Singularitäten“13 ausbilden. Deren identitätspolitisches, aufgrund verschärfter Abgrenzungen zum „Anderen“ auch konfliktträchtiges Potential hat sich in den letzten Jahrzehnten seit dem Ende des Kalten Krieges zunehmend verstärkt: Behauptungen von Einzigartigkeiten und stabilen Traditionen, die ethnische, religiöse, kulturelle und soziale Gruppierungen imaginär miteinander verbinden, scheinen sich zu radikalisieren und zweifellos auch neue Formen von Rassismus bzw. „Rassifizierungen“ zu befördern. Doch dürfte der Umstand, dass sich in der zeitgenössischen Rassismusforschung bislang keine eindeutige Rassismusdefinition hat etablieren können, eben auch mit der Diskursivität, Relativität und historischen Variabilität zu tun haben, die Phänomen, Begriff und Formen von Rassismus seit jeher begleiten. Damit ist der (ja zwingend notwendige) Versuch einer begrifflichen Erfassung von Rassismus nicht diskreditiert. Nur sollte er zugleich mit einer kritischen Reflexion der die Religions-, Kultur- und Zivilisationsgeschichte begleitenden Momente des Ideologischen verbunden sein.
Dem UEM-Bericht zufolge sind es „unbewusste Vorverständnisse, Fehlinformationen und pauschale Ängste, aber auch strukturelle Benachteiligungen“, die „zu einer rechtsstaatswidrigen und feindlichen Spaltung der Gesellschaft in ein ‚Wir‘ und ‚die Anderen‘“ führen und in der Konsequenz schließlich den Rechtsstaat zum Handeln zwingen: Als dessen „Essenz“ wird der „Schutz von Minderheitenrechten, bisweilen auch entgegen der Mehrheitsmeinung“ benannt und zugleich hervorgehoben, dass die „Probleme eines islamisch-religiös begründeten Extremismus“ „nicht Gegenstand des Arbeitsauftrags des UEM“ sind, sondern bereits „anderweitig behandelt“ (UEM, 7 und 20) wurden. Nimmt man die Ergebnisse des UEM-Berichts und die Datenlage mit Blick auf die erhobene Differenz zwischen Vorbehalten gegenüber dem Islam als Religion und den Muslimen als Mitbürgern ernst, erweisen sich aber gerade die Phänomene des Extremismus im islamischen Kontext bzw. des Dschihadismus als ein zentrales Motiv antimuslimischer Ressentiments, das im Kontext der Erfassung und Bekämpfung von AmR nicht nur eine eigenständige, sondern vor allem eingehendere Behandlung im UEM-Bericht selbst – und nicht nur „anderweitig“ – verdient hätte. Und es ist zudem historisch kaum von der Hand zu weisen, dass Formen von Diskriminierung, Abwertung und Rassismus kein Prärogativ hegemonialer Mehrheiten sind, sondern sehr oft auch von gesellschaftlichen Minderheiten ausgehen (Stichwort muslimischer Antisemitismus, religiös begründeter Extremismus). Doch werden diese sowohl nach innen als auch nach außen gerichteten Abgrenzungspraktiken im Gesamthorizont der Selbststilisierung als Opfer hegemonialer Mehrheiten selten als Formen von Rassismus wahrgenommen.
Antisemitismus – Relationen zur Muslimfeindlichkeit
Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 wurde die Fachtagung der Deutschen Islam Konferenz zum Bericht des UEM im November 2023 um das Themenfeld Antisemitismus erweitert. Die Antirassismus-Beauftragte des Bundes, Reem Alabali-Radovan, mahnte dort eine stärkere Fokussierung auf die von AmR direkt Betroffenen an und stellte sich zugleich vehement gegen gelegentlich geäußerte politische Forderungen nach einer Reziprozität in der Gewährung und Beanspruchung von Toleranz und im Engagement gegen Hass und Hetze: „Niemand“ müsse „in Vorleistung gehen, um vor Rassismus geschützt zu werden.“14 Anders hingegen argumentiert der jüngste Bericht des „Religionsmonitors“,15 in dem betont wird, dass „für Deutschland das Eintreten gegen jede Form des Antisemitismus zusätzlich auch eine aus der historischen Verantwortung gewachsene Bedeutung“ habe: „Das anzuerkennen und mitzutragen, ist eine Grundüberzeugung des Zusammenlebens in unserem Land und gilt für Alteingesessene ebenso wie für Zugewanderte.“ Die noch vor der aktuellen Verschärfung des Nahostkonflikts durchgeführten Erhebungen des „Religionsmonitors“ zeigen zum einen, „dass antisemitische Haltungen sich nicht auf Deutschland beschränken, sondern in weiten Teilen der europäischen Bevölkerung verbreitet sind“, zum anderen, „dass in der muslimischen Bevölkerung antisemitische Vorurteile stärker verbreitet sind als in der deutschen Bevölkerung insgesamt“:16 So stimmen, um nur ein Item zu nennen, dem Vergleich Israels mit dem Nationalsozialismus – „was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben“17 – in der deutschen Gesamtbevölkerung 43 Prozent, unter den Muslimen hingegen 68 Prozent zu. Letztere neigen zudem nochmals verstärkt der Vorstellung einer „jüdischen Weltverschwörung“ zu, der zufolge „Jüdinnen und Juden, parallel dazu auch Israel, das Weltgeschehen kontrollieren und beispielsweise die Medien, die Justiz und politische Parteien lenken“. Mitbegründet sieht der „Religionsmonitor“ eine solche Haltung auch in religiösen Einflussfaktoren. Denn die „wenig“ bis „gar nicht“ religiösen Muslime unterscheiden sich in ihrer Haltung kaum von der Gesamtbevölkerung, wohingegen „Lesarten des Islams, die eine historisch bedingte Feindschaft zwischen Muslim:innen und Jüdinnen und Juden behaupten“,18 sich als besonders problematisch und umso wirkmächtiger erweisen, je weniger Beheimatung Muslime mit ihrer Religion in Deutschland erleben: Dann wird „die Verbindung zu ihrem Herkunftsland und den dort verbreiteten Lesarten umso bedeutsamer“.
Bildung – Vom überbetonten Differenzaspekt zur „religious literacy“
Mit den Stichworten „Lesarten“, „Herkunft“ und „Beheimatung“ sind Momente religiöser und politischer Bildung aufgerufen, die auch im Kontext eines entsprechenden UEM-Kapitels behandelt werden und zu kritischen Rückfragen veranlassen. Dem UEM-Bericht zufolge impliziert in der Betrachtung sozialer Probleme bereits „der anerkennende Blick auf Unterschiede die Gefahr der Überbetonung des Differenzaspekts“ bzw. „die Gefahr einer Kulturalisierung und Ethnisierung von Differenz“, mit den bekannten Assoziationen einer „vermeintliche[n] Andersartigkeit, Kulturdifferenz und Fremdheit“ (UEM, 137). Gleiches gilt auch für Sachkritik am Islam bzw. die sogenannte „Islamkritik“, die ebenfalls im Horizont eines bereits bestehenden Zusammenhangs zwischen individuellem und strukturellem Rassismus problematisiert wird: Selbst „wenn eine einzelne Person eine bestimmte Kritik an einer islamisch motivierten Praxis vielfach zu Recht übt, ist sie Teil einer Diskursprägung, die in ihrer Gesamtheit einen generalisierenden Charakter trägt und damit rassistische Routinen ausprägen kann. Der Islam erscheint dann am Ende mehr als eine politische Ideologie und nicht als eine Religion mit diversen Lehren und Praxen“ (UEM, 39). Damit entkommen auch sachliche, zum Beispiel aus einer menschenrechtlichen Perspektive erhobene Einwände gegenüber islamischen Auffassungen, Lesarten und Praktiken nur schwer dem Verdacht, antimuslimische Ressentiments zu befördern. Der Bericht zitiert etwa vielfach die an der Alice Salomon Hochschule Berlin lehrende Sozialpädagogin Iman Attia, für die sich AmR „aus den Komponenten Essenzialisierung und Dominanz“ (UEM, 28) zusammensetzt und für die „auch die ‚aufklärerisch-menschenrechtliche Islamkritik‘ […] von einer Position ausgeübt“ wird, „die ihre eigene Zugehörigkeit als überlegen setzt“.19
Der kirchlich geführte christlich-muslimische Dialog bleibt von dieser Kritik ebenfalls nicht ausgenommen. Zwar spricht der Bericht hinsichtlich des in den Mitgliedskirchen der EKD geführten Dialogs von „unterschiedlichen Akzentsetzungen in Richtung Abgrenzung oder Verständigung“. Doch enthalte zum Beispiel das EKD-Dokument „Klarheit und gute Nachbarschaft“ (2006) „umfangreiche staatspolitische Passagen mit einer deutlichen Tendenz zur Abgrenzung und vergleichsweise wenige Inhalte zu theologischen und interreligiösen Themen“, wie in Aufnahme einer Kritik von Karl-Josef Kuschel moniert wird (UEM, 291). So seien Aussagen wie „Ihr Herz werden Christen jedoch schwerlich an einen Gott hängen können, wie ihn der Koran beschreibt und wie ihn Muslime verehren“ „von manchen als befremdlich und als verletzend empfunden“ worden (ebd.).
Gegenüber solchen kritischen, sich dem Verdacht der Rassifizierung aussetzenden Bezugnahmen auf Religion im Allgemeinen und den Islam im Besonderen wird im UEM-Bericht wiederholt der Wunsch nach „mehr religiöser Bildung“ bzw. einer „religious literacy“ geäußert, die inhaltlich jedoch nicht als „eine Expertise zu einzelnen Religionen“ beschrieben wird, sondern als die Fähigkeit zur Unterscheidung „zwischen Religion, Ideologie und Politik“ (UEM, 128) sowie zum Verstehen „historische[r] und gegenwärtige[r] Bedingungen und Ausdrucksformen religiösen Denkens und Handelns“ (UEM, 152 und 158). Worauf damit abgehoben ist, wird nochmals dort transparenter, wo der Bericht auf die dialogische Zusammenarbeit in „als gemeinsame Verantwortung identifizierten und bearbeiteten Felder[n]“ verweist. Diese reichen „von der Telefon-, Notfall-, Klinik-, Gefängnis- oder Militärseelsorge bis hin zum Klimaschutz, von karitativer Arbeit bis zu ethischen Fragen“ (UEM, 293) und ermöglichen eine das zivilgesellschaftliche Engagement befördernde Anerkennung religiöser Lebenswelten als selbstverständliches Fundament bürgerschaftlicher Partizipation.
Dass eine solche „religious literacy“ in der Tendenz mit Verkürzungen und Ausblendungen einhergeht, zeigt sich im Bericht bereits in den Darstellungen öffentlicher, von muslimfeindlicher Rhetorik gekennzeichneter Debatten. Im kritischen Referat zu den in der deutschen Bevölkerung bislang noch ausgeprägten Vorbehalten gegenüber dem Kopftuch muslimischer Lehrerinnen – dem 49 Prozent ablehnend gegenüberstehen – plädiert der Bericht, um nur ein Beispiel zu nennen, für „eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Unterschieden zwischen Islam und islamistischem Extremismus […], indem beispielsweise der ‚Dschihad‘ in seiner primären islamisch-religiösen Deutung erläutert und die Instrumentalisierung des Begriffs durch Extremist*innen aufgezeigt wird“ (UEM, 143). Überzeugend erheben lässt sich eine solche „primäre islamisch-religiöse Deutung des Begriffs ‚Dschihad‘“ aus historischer oder quellenbezogener koranischer Perspektive aber nur schwer. Zu einer Chiffre für den spirituellen Kampf bzw. Dschihad („Einsatz“) des Einzelnen gegen die eigene Triebseele entwickelte sich der in den medinischen Suren zunächst bzw. „primär“ militärisch konnotierte Begriff erst sehr viel später, insbesondere mit der Blüte islamischer Mystik im 10. und 11. Jahrhundert u. Z.
Traditionslinien – Polemik und Bedrohungsszenarien
Einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen auch die kurzen, um nicht zu sagen holzschnittartigen Ausführungen des insgesamt über 400 Seiten umfassenden UEM-Berichts zu den Gründen für die beobachtete Muslimfeindlichkeit. Auf knapp einer Seite stellt er „historische Traditionslinien“ (UEM, 31, Abschnitt 2.4) vor, die der gegenwärtigen Muslimfeindlichkeit geschichtliche Anknüpfungspunkte und Legitimationsressourcen liefern: Genannt werden die Abwertungen des Islam als eine „christliche Irrlehre“ in der „antiislamischen Kontroversliteratur“ sowie Herabwürdigungen und „polemische Verzerrungen […] Muhammads als ‚Lügenprophet‘“ oder des „Koran als ‚Fabelbuch‘“, dann das sich ab dem 15. Jahrhundert ausbildende „Feindbild der ‚Türkengefahr‘“ und schließlich ein europäisches, sich in der Zeit des Kolonialismus verstärkendes „Überlegenheitsdenken […], das Europa und den Islam als zwei gegensätzliche ‚Zivilisationen‘ zu bestimmen suchte“.
Als „markante Ereignisse“, welche die jüngere Geschichte der europäischen Islam- und Orientwahrnehmung begleiten und den Fundamentalismusverdacht gegenüber dem Islam mitbegründen, werden punktuell die iranische Revolution 1979 und 9/11 genannt, umfassendere religionsgeschichtliche und gesellschaftliche Dynamiken sowie die weit ins 20. Jahrhundert hineinreichende Genealogie fundamentalistischer Strömungen im modernen Islam bleiben dagegen unberücksichtigt. Zumindest eine Erwähnung verdient hätte das Wiedererwachen eines islamischen Extremismus nach dem Sechstagekrieg von 1967, die Zuspitzung der Israel-Palästina-Frage in den 1970er Jahren (Olympia-Attentat München 1972) und, über die iranische Revolution 1979 hinaus, insbesondere die Fatwa Khomeinis gegen Salman Rushdie bzw. die sogenannte Rushdie-Affäre 1989. Letztere darf im Rückblick als ein Ereignis gelten, das mit dem Ende des Ost-West-Konflikts nahezu gleichbedeutend ist, das die Beziehungen zwischen dem „Westen“ und dem „Islam“ grundlegend mitbestimmt und fortan alle westlichen Islam-Debatten geprägt hat. Erwähnenswert wäre ferner die makrosoziologische Dimension von Islamfeindlichkeit gewesen, die Oliver Wäckerlig nicht zu Unrecht auch als eine Folge der sich in den 1990er Jahren abzeichnenden Transformation vieler ursprünglich antikommunistischer Organisationen beschreibt. Diese nahmen nach dem Ende des Kalten Kriegs eine Neufokussierung ihres Feindbildes auf den Islam vor und begriffen dessen Selbstorganisation nicht mehr als „legitime innergesellschaftliche Interessensvertretung“, sondern als einen „die Gesellschaft unterminierenden Faktor“.20 Dabei wurden, so Wäckerlig weiter, „geopolitische Bedrohungsszenarien durch ein Verständnis von Islam als einer expansiven politischen Ideologie, dem ‚Islamismus‘, aufrechterhalten“. Wachgehalten wurden diese gleichwohl, das sollte hier nicht unterschlagen werden, durch wiederkehrende „markante Ereignisse“,21 die es einer den Islam als politische Ideologie deutenden Einstellung erlaubt, mit Blick auf die islamistische Bewegung auch auf reale Entwicklungen und Phänomene zu verweisen. Und sie schufen, wie Wäckerlig zu Recht betont, in der Verallgemeinerung eine „Distanz erzeugende Typisierung“22 muslimischer Akteure, die im UEM-Bericht nochmals eine hermeneutische Vertiefung hätte vertragen können.
Herausforderungen: Sich gegenseitig befördernde Radikalisierungen
Extremismen – Desillusionierung, Islamfeindlichkeit und Kulturkampf
Dass sich diskriminierte oder ausgegrenzte Menschen anfällig für die Narrative konservativer Religionsauslegungen und damit für Radikalisierungen zeigen, hat die Radikalisierungsforschung vielfach und nicht nur mit Blick auf den Islam aufgezeigt. Im Kontext des Letzteren wird der Prozess der Radikalisierung nochmals durch eine voranschreitende sozio-emotionale Desintegration von Teilen der schon länger hier lebenden Muslime bzw. der dritten Einwanderergeneration befördert. Auf der zum Bericht der UEM anberaumten Fachtagung der Deutschen Islam Konferenz im November 2023 schilderte Omar Kuntich, Vorstandsvorsitzender der malikitischen Gemeinde Deutschlands, die zunehmende, durch den Nahostkonflikt nochmals verstärkte Desillusionierung und Entfremdung junger muslimischer Migranten und mahnte, die damit verbundene Gefahr ihrer Radikalisierung nicht zu unterschätzen und sie durch vertrauensbildende Maßnahmen und Gegennarrative in ihrer Wirkmacht einzugrenzen. Es sei, so Kuntich, eine „Herkulesaufgabe“, diesen Menschen wieder das Vertrauen in die Demokratie zurückzugeben, das sie zur Flucht aus ihren teils von autoritären Regimen beherrschten oder von Kriegen heimgesuchten islamischen Herkunftsländern veranlasste: Nicht soziale Leistungen oder das Wohlstandsversprechen des deutschen Staates sind es, die sie zur Migration nach Deutschland bewogen, sondern durch die Verfassung verbürgte Freiheitsrechte und gemeinsame Spielregeln für alle. Auch die Grünenpolitikerin Lamya Kaddor äußerte die Befürchtung, dass immer mehr muslimisch gelesene Menschen mit diesem Land brechen und in der Gefahr stehen, sich instrumentalisieren zu lassen und für den religiös begründeten Extremismus anschlussfähig zu werden.
Die vom BMI geförderte GmbH „Modus – Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung“ betreibt seit 2020 eine Netzwerkanalyse, die mit einem spezifischen Fokus bzw. „Themenschwerpunkt“ die Peripherie des religiös begründeten Extremismus erforscht. Seit 2021 gehört dazu auch ein Monitoring salafistischer Akteure bzw. der von ihnen online kommunizierten Inhalte. War im Jahr 2021 noch vornehmlich die Videoplattform YouTube im Blick, wurden seit 2022 auch TikTok und seit 2023 Instagram ins Monitoring aufgenommen. Die laufende Netzwerkanalyse ermöglicht einen Einblick in die Dynamiken der von den Akteuren vorangetriebenen Kommunikationsstrategie, die YouTube, TikTok und Instagram in Predigerportalen und Spiegelvideos miteinander verbindet und teils ausgesprochen hohe Aufrufzahlen generiert.23
Während sich die salafistischen, primär von Saudi-Arabien gesteuerten und lizensierten Plattformen – bedingt auch durch die Politik des Kronprinzen Mohammed bin Salman („MBS“) und dessen Agenda „Saudi Vision 2023“ – mit antisemitisch konnotierten Inhalten und politischen Visionen eher zurückhalten, machen die mittelbar von der 2003 in Deutschland verbotenen Ḥizb at-taḥrīr gesteuerten Kanäle wie @GenerationIslam, @RealitätIslam und @MuslimInteraktiv keinen Hehl aus ihrer israel- und judenfeindlichen Grundeinstellung und ihren politischen Ambitionen. Zu den von diesen Plattformen und ihren Spiegelkanälen immer wieder neu aufgelegten Leitthemen gehören zentral die Bedrohung des Islam durch den Westen, die innerhalb westlicher Staaten erlebte Diskriminierung und Islamfeindlichkeit und die Vision von einem erneuerten, die muslimische Welt wieder zusammenführenden Kalifat. Vom Kolonialismus über den von den USA angeführten, als Kampf gegen den Islam gelesenen „Kampf gegen den Terror“ bis hin zum Israel-Palästina-Konflikt zeichne sich in historischer Perspektive – nach den ersten beiden Epochen des Prophetentums und des Kalifats – in der gegenwärtigen Epoche der Gewaltherrschaft ein regelrechter „Kulturkampf “ ab, der den Islam zu zerstören beabsichtige und durch ein erneuertes Kalifat beendet werden müsse. Die propagierte und proleptisch imaginierte transnationale Einheit der zu neuer Stärke geführten Umma werde allerdings erst dann Realität, wenn ihre durch nationalstaatliche Grenzen herbeigeführte Spaltung, die die Kontrolle islamischer Länder durch den Westen ermögliche, wieder rückgängig gemacht sei. Nach diesem auf den genannten Kanälen in unzähligen Variationen kommunizierten Narrativ erzwinge der deutsche Staat mit seiner als Staatsräson legitimierten Parteinahme für Israel eine Unterwerfung muslimischer Verbände und bringe sie dazu, zu den als Genozid an den Palästinensern bezeichneten Maßnahmen der Vergeltung für das Hamas-Massaker zu schweigen. „Wahre Muslime“ hingegen seien – als die authentischen Vertreter des Islam – zum „Einsatz ( ǧihād) für die Sache des Islam“ aufgerufen und vermöge dessen zugleich individuell durchs Gericht hindurch gerettet. Dass sie dabei auch aus nichtmuslimischer Perspektive auf der richtigen Seite kämpfen, vermittelt ihnen ein als „Pflichtvideo“ beschriebener und mit weit über 100.000 Aufrufen bei Abul Baraa (YouTube) eingestellter Vortrag des Nahostexperten Michael Lüders, der mit seiner „absolut sachgerechten“ Beschreibung des Israel-Palästina-Konflikts die Sicht der „wahren Muslime“ auf eben diesen Zusammenhang vollauf bestätigt und damit ihren Kampf für die gerechte Sache aus gleichsam neutral-wissenschaftlicher Perspektive legitimiert.24
Toxische Echokammern und unkonventionelle Maßnahmen
Mögen die auf den einschlägigen Kanälen kolportierten Narrative auch nirgendwo direkt zur Gewalt aufrufen, so legen sie doch nahe, dass der Konflikt eskalieren werde, dass für die Opfer der eigenen (palästinensischen) Seite keine Empathie zu erwarten und dass es somit nötig sei, „für die Sache des Islam aktiv“ zu werden. In einer mit Blick auf die andere, christliche Seite vorgenommenen und für den UEM-Bericht 2023 vorgelegten explorativen Studie zur „Islamfeindschaft in christlichen Medien“25 sind die dort beobachtbaren Echokammern zu Recht als „toxische Diskursräume“ beschrieben worden. Als toxisch erweisen sich neben den digitalen Echokammern im Kontext rechtspopulistischer Milieus zweifellos auch die im digitalen Raum kursierenden Viktimisierungsnarrative von Muslimen, die sich als missachtete Opfer sowohl europäischer als auch nahöstlicher Machtpolitik sehen, sich benachteiligt, ausgegrenzt und diskriminiert fühlen und subjektiv unter erheblichen Teilhabe- und Anerkennungsdefiziten leiden. Beunruhigen muss dabei der Umstand, dass islamistische Akteure die mit Islamfeindlichkeit und antimuslimischem Rassismus verbundenen Konzepte teilweise auch dafür nutzen, ihren Kulturkampfanalysen und Zukunftsvisionen die nötige Überzeugungskraft zu verleihen. Umfassende explorative Studien zu diesen innermuslimischen Echokammern stehen noch aus. Um deren Wirkmacht nachhaltig zu brechen, wird es, wie auch Migrationsforscher immer wieder betonen, einer verstärkten Einbeziehung von Akteuren aus den migrantischen Gemeinschaften bedürfen.
In welchem Maße dabei auch unkonventionelle Maßnahmen wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Moscheegemeinden aus dem salafistischen Spektrum sinnvoll erscheinen, wird derzeit von politischen und zivilgesellschaftlichen Verantwortungsträgern durchaus kontrovers diskutiert. Der UEM-Bericht zumindest empfiehlt, unkonventionelle Partner nicht von vornherein mit einem Generalverdacht zu belegen, wenn Kooperationen mit ihnen nicht ausgeschlossen bleiben sollen: Sie können, so der Bericht, auch „als Auffangbecken für ehemalige Mitglieder dschihadistischer Gruppen dienen“ und damit „eine integrative Wirkung entfalten“ (UEM, 226). Mit dieser Einschätzung dürfte er nicht ganz falsch liegen – zumindest für die Stadt Berlin. Dort haben die im „Rat der Berliner Imame“ vernetzten Geistlichen in den Tagen und Wochen, die auf das 9/11 Israels, das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 („10/7“) folgten, alles gegeben, um deeskalierend in die muslimische Community hineinzuwirken und die erhitzten Gemüter zu beruhigen, durchaus mit erheblichem Erfolg – von Ausnahmen wie der Sonnenallee einmal abgesehen. Diesen Erfolg zu würdigen und das damit verbundene politische Kraftfeld zu nutzen, könnte für eine aussichtsreiche Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit möglicherweise sehr viel mehr austragen als manche Handlungsempfehlung des UEM-Berichts. Welche Maßnahmen sich darüber hinaus als sinnvoll und nachhaltig erweisen, wird die weitere Zukunft zeigen. Schon jetzt dürfte allerdings kein Zweifel an der Dringlichkeit bestehen, den Radikalisierungsschleifen, die sich an den Rändern der Gesellschaft entwickeln und sich gegenseitig befördern, in einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung etwas entgegenzusetzen. Wenn es auch illusorisch wäre, diese Radikalisierungsschleifen (oder auch: -spiralen) vollständig eindämmen zu können: Eine nachhaltige Reduktion ihres den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohenden Gefahrenpotentials wird wohl nur möglich sein, wenn der Kontakt zu den davon Betroffenen nicht vollständig abreißt.
Rüdiger Braun
Anmerkungen
- Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) (Hg.), „Muslimfeindlichkeit. Eine deutsche Bilanz. Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit“, Berlin, Juni 2023, www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/forschungsbericht-muslimfeindlichkeit-2233236 (im Folgenden mit „UEM“ vor der Seitenzahl abgekürzt).
Dies sind (1) die „Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS), (2) die „Mitte-Studien“ der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-Mitte-Studien), (3) die Studienreihe „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (GMFSurveys), (4) die seit 2002 durchgeführten und seit 2018 als „Leipziger Autoritarismus-Studien“ benannten „Leipziger Mitte-Studien“ (Leipziger M-A-S) sowie (5) der seit 2007 durchgeführte „Religionsmonitor“ der Bertelsmann Stiftung.
Bertelsmann Stiftung (Hg.), „Antisemitismus, Rassismus und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ein Blick auf Deutschland in Zeiten der Eskalation in Nahost“, Religionsmonitor kompakt, Berlin, Dezember 2023, 9, www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/antisemitismus-rassismus-und-gesellschaftlicher-zusammenhalt; vgl. dazu auch UEM, 24.
Bertelsmann Stiftung, „Antisemitismus“, 10.
Sarah Perry, Ipek Göcmen, Rima Hanano und Güzin Ceyhan, „Erfahrungen und Umgangsstrategien von Betroffenen von antimuslimischem Rassismus“, CLAIM, Berlin, Juli 2023, https://www.claim-allianz.de/content/uploads/2023/12/231205_claim_erfahrungen-und-umgangsstrategien-von-betroffenen-von-antimuslimischem-rassismus.pdf.
So eines der Ergebnisse der von Andreas Zick (Universität Bielefeld) vorgenommenen Quantitativstudie zu „Muslimischen Perspektiven auf Muslim- und Islamfeindlichkeit“ (MuPe), die im Rahmen der digitalen Vorstellung der CLAIM-Studie im Dezember 2023 zur Sprache kam.
Andreas Reckwitz, „Zwischen Hyperkultur und Kulturessenzialismus. Die Spätmoderne im Widerstreit zweier Kulturalisierungsregime“, Jahrbuch für Kulturpolitik 2017/18, 81– 90.
Étienne Balibar, „Gibt es einen Neo-Rassismus?“, in: Étienne Balibar und Immanuel Wallerstein, Rasse-Klasse-Nation. Ambivalente Identitäten (Hamburg: Argument Verlag, 1992), 23–38, 28; zum Rassismusbegriff immer noch einschlägig: Urs Altermatt und Damir Skenderovic, „Kontinuität und Wandel des Rassismus. Begriffe und Debatten“, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 53,9 (2005), 773–790.
Robert Miles, Rassismus. Einführung in die Geschichte und Theorie eines Begriffs (Hamburg: Argument Verlag 1991), 57ff.
Arata Takeda, „Konsequenzen von Kulturalismus. Von konfrontativen zu partizipativen Ansätzen in der Vermittlung von Sprache, Kultur und Werten“, vorgänge, Nr. 217 (2017), 127–139.
- Vgl. Takeda, „Konsequenzen von Kulturalismus“, 130.
- Er knüpft damit an die Empfehlungen der „Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz“ (ECRI General Policy) an.
Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne (5. Aufl., Berlin: Suhrkamp, 2018).
Reem Alabali-Radovan, Gesprächsbeitrag zur Podiumsdiskussion der Fachtagung der Deutschen Islam Konferenz am 21./22. November 2023: „Sozialer Frieden und demokratischer Zusammenhalt. Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung“, eigene Aufzeichnungen.
Bertelsmann Stiftung, „Antisemitismus“; nachfolgendes Zitat: ebd., 11.
Bertelsmann Stiftung, „Antisemitismus“, 3 und 5.
Dementsprechend werde die „Situation der Palästinenser:innen heute […] mit der Lage der Jüdinnen und Juden zu Zeiten des Nationalsozialismus gleichgesetzt“ (Bertelsmann Stiftung, „Antisemitismus“, 2; nachfolgende Zitate: ebd., 3).
Demgegenüber sind „bei hochreligiösen Christ:innen antisemitische Haltungen insgesamt deutlich weniger verbreitet […] als unter den weniger religiösen Christ:innen“ (Bertelsmann Stiftung, „Antisemitismus“, 7; nachfolgendes Zitat: ebd.).
Iman Attia, „Antimuslimischer Rassismus in bester Gesellschaft“, in: Iman Attia, Alexander Häusler und Yasemin Shooman, Antimuslimischer Rassismus am rechten Rand (Münster: Unrast, 2014), 9–33, 24.
Oliver Wäckerlig, Vernetzte Islamfeindlichkeit. Die transatlantische Bewegung gegen ‚Islamisierung‘. Events – Organisationen – Medien (Bielefeld: transcript, 2018), 385; nachfolgendes Zitat: ebd., 15.
Hier hätten nach 9/11 genannt werden können: die Ermordung von Theo van Gogh 2004, die Terrorattentate von Madrid 2004 und London 2005, der Karikaturenstreit von 2006, die Terroranschläge von Paris 2015 (Bataclan, Charlie Hebdo) sowie die Anschläge in Nizza und am Berliner Breitscheidplatz 2016.
Wäckerlig, Vernetzte Islamfeindlichkeit, 38.
Zu den bekanntesten Online-Kanälen und deren Aufrufzahlen im Jahr 2022 vgl. Rüdiger Braun, „Ressentiment, Resignation und Rückzug. Zur Radikalisierung junger muslimischer Migranten“, ZRW 87,1 (2024), 25–43, 37.
Vgl. dazu die zahlreichen Kommentare zum Vortragsvideo: Abul Baraa Tube, „Findet ihr[,] dieser Nahostexperte sagt als Nichtmuslim über Israil [sic] die Wahrheit?“, YouTube, 12.10.2023, https://youtu.be/A-3lv6q3TXg.
Gritt Klinkhammer, Jacob Chilinski und Rosa Lütge, „Islamfeindlichkeit in christlichen Medien. Eine qualitative Studie zu antimuslimischem Rassismus in ausgewählten christlichen Online-Medien“, Veröffentlichungen des Instituts für Religionswissenschaft und Religionspädagogik 12, Universität Bremen, 2023, https://doi.org/10.26092/elib/2371.
Der Artikel wurde in Heft 2/2024 der „Zeitschrift für Religion und Weltanschauung“ (ZRW) erstveröffentlicht. Es handelt sich hierbei um eine digitale Zweitveröffentlichung mit Zustimmung des Verlags.
Ansprechpartner
 PD Dr. theol. Rüdiger Braun
PD Dr. theol. Rüdiger BraunAuguststraße 80
10117 Berlin